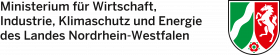„Insgesamt haben wir an der RWTH Aachen eine extrem gründungsfreundliche Haltung wahrgenommen.“

© Jein Studio, Netherlands
Ein neuer Ansatz in der Medizintechnik: Der Darm als Schlüssel zur Atmung. Das Aachener Start-up O11 biomedical GmbH hat eine innovative Therapie entwickelt, die den menschlichen Darm nutzt, um die Atmung bei schwerer Lungenerkrankung zu unterstützen. Mit einer bahnbrechenden Methode zur Reduktion von Kohlenstoffdioxid im Blut, bietet das Team eine Alternative zur herkömmlichen Beatmung. Unterstützt von der RWTH Innovation sowie dem Institut für Angewandte Medizintechnik der RWTH Aachen und dem Universitätsklinikum Aachen, arbeitet das interdisziplinäre Team aus Biologinnen, Medizinern und Ingenieuren daran, die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Co-Founder Dr. Richard Ramakers erklärt im folgenden Interview, worum es dabei geht.
Herr Dr. Ramakers, Ihr Ziel ist es, die Therapie der Hyperkapnie zu revolutionieren. Um was geht es dabei? Und was ist das Revolutionäre daran?
Dr. Ramakers: Dazu muss man einmal zunächst wissen, um was es sich bei einer Hyperkapnie genau handelt. Über unsere Lunge nehmen wir Sauerstoff auf und atmen die verbrauchte Luft in Form von Kohlenstoffdioxid wieder ab. Das passiert tagaus, tagein. Wenn dieses System nun gestört ist, weil unsere Lungen nicht richtig funktionieren oder unser Körper zu schwach ist, führt dies dazu, dass sich das Kohlenstoffdioxid im Körper anhäuft. Dieser Zustand wird als Hyperkapnie – als zu viel CO2 im Blut – bezeichnet. Im Ergebnis kommt es zu einer Übersäuerung des ganzen Körpers, was letztlich zu erheblichen Organschäden führt. Wir haben nun ein neues Verfahren entwickelt, das den Darm als alternatives Atmungsorgan bei schweren Lungenerkrankungen nutzt.
Welche Patientinnen und Patienten betrifft das?
Dr. Ramakers: Davon betroffen sind in erster Linie Menschen mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, besser bekannt unter COPD. Dabei werden die Atemwege immer enger – wobei Rauchen, Luftverschmutzung und andere Umweltfaktoren die Verursacher sind. Die Krankheit gehört weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Eine weitere Patientengruppe bilden ältere Menschen oder Menschen nach langer Beatmungsdauer auf der Intensivstation, deren Atemmuskulatur zu schwach ist, um noch selbstständig atmen zu können. Und nicht zuletzt haben wir noch eine dritte Patientengruppe: Das sind frühgeborene Kinder mit noch unreifen Lungen.
Und wie werden diese Patientinnen und Patienten üblicherweise behandelt?
Dr. Ramakers: Die Lunge von COPD-Patientinnen und -Patienten wird in der Regel mit einer automatischen Pumpe, dem Beatmungsgerät, unterstützt, so dass sie besser Sauerstoff aufnehmen und Kohlenstoffdioxid abgeben können. In der Regel verbringen die Patienten ungefähr 6 Stunden täglich mit dieser Druckbeatmung. In der Zeit müssen sie liegen oder sitzen und eine Atemmaske tragen. Sie sind also nicht mobil, können nicht sprechen; sie sind sozial isoliert. Insgesamt handelt es sich also um eine sehr unangenehme Therapie.
Und dazu haben Sie eine Alternative entwickelt?
Dr. Ramakers: Richtig. Wir bieten einen komplett anderen Therapieansatz an. Im Mittelpunkt steht dabei die Fähigkeit des Darms, Kohlenstoffdioxid vom Blut in die Darmflüssigkeit zu transportieren. Wenn wir nun das CO2 in der Darmflüssigkeit an Partikel binden, können wir es auf natürlichem Weg während des Toilettengangs aus dem Körper ausscheiden. Der Darm unterstützt damit praktisch die Atemfunktion der Lunge. Dieses Prinzip haben sich Professor Stefan Jockenhövel und Dr. Christian Cornelissen zunutze gemacht und die Idee eines flüssigen Therapeutikums, ähnlich eines Smoothies, entwickelt. Im Ergebnis wird es so aussehen, dass die Patientinnen und Patienten etwa dreimal am Tag ein Glas davon trinken und damit das überschüssige Kohlenstoffdioxid über ihren Darm abführen. Das Ganze ist also sehr einfach in der Handhabung und erlaubt ihnen, wieder am sozialen Leben teilzuhaben.
Wie kamen Sie auf diese Idee?
Dr. Ramakers: Wir hatten uns zunächst mit neuen Beatmungstherapien bis hin zur Entwicklung von künstlichen Lungen beschäftigt. Dabei haben wir aber gemerkt, dass „immer invasiver“ und „immer komplexer“ nicht dauerhaft zum Ziel führe. Daher haben wir „outside the box“ gedacht und wie man sich das so vorstellt im Biergarten verrückte Ideen gesponnen. Das waren praktisch die Anfänge von RESPILIQ™, dem von uns entwickelten Medizinprodukt.
Sie haben Prof. Jockenhövel und Dr. Cornelissen bereits genannt. Wer ist darüber hinaus an der Entwicklung beteiligt?
Dr. Ramakers: Zu unserem Team gehören außerdem die Biologin Dr. Caroline Kniebs sowie Stefan Siebert, der wie ich, Ingenieur ist. Wir fünf sind nicht nur an der Entwicklung von RESPILIQTM beteiligt, sondern haben alle zusammen auch die O11-biomedical GmbH gegründet. Als Mitarbeiterin ist auch noch die Biologin Anna Wichterich mit an Bord. Damit sind wir sehr gut aufgestellt.
Haben Sie auch eine unternehmerisch erfahrene Person im Team?
Dr. Ramakers: Ja, sowohl Stefan Jockenhövel als auch ich hatten bereits verschiedene Gründungen begleitet und darüber hinaus die finanzielle Verantwortung für große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen getragen. Von daher sind wir mit betriebswirtschaftlichen Fragen vertraut.
Bei der Gründung der O11-biomedical GmbH wurden Sie von der RWTH Innovation unterstützt. Was empfanden Sie als besonders hilfreich?
Dr. Ramakers: Insgesamt haben wir an der RWTH Aachen eine extrem gründungsfreundliche Haltung wahrgenommen. Das hat sich nicht zuletzt bei den Konditionen gezeigt, zu denen wir die IP-Rechte an unserem Verfahren erhalten haben. Als Stefan Jockenhövel und Christian Cornelissen noch am AME, am Institut für Angewandte Medizintechnik der RWTH Aachen, mit den Entwicklungsarbeiten an RESPILIQTM beschäftigt waren, hatte das Institut die ersten Patente angemeldet. Je mehr wir uns aber auf unsere Ausgründung zubewegt haben, wurde uns klar, dass wir als Start-up-Team über unser intellektuelles Eigentum selbst verfügen müssen. Die RWTH Innovation hat uns dann bei der Frage, wie die Übertragung der Patentrechte aussehen könnte, sehr unterstützt, so dass es im Ergebnis zu einer sehr gründerfreundlichen und fairen Regelung für alle Beteiligten kam.
Wie sah diese Regelung aus?
Dr. Ramakers: Die RWTH hat uns die Rechte an den Patenten übertragen. Im Gegenzug ist die RWTH Innovation an unserer GmbH beteiligt. Gerade in der frühen Phase der Unternehmensentwicklung verzichtet die Hochschule dabei auf Zahlungen, so dass wir uns optimal aufstellen können. Für ein junges Unternehmen, das sich erst einmal einen Platz auf dem Markt erobern muss, ist das natürlich eine sehr liquiditätsfreundliche Variante, die die Entwicklung des Start-ups nachhaltig fördert.
Abgesehen von der Frage der IP-Übertragung: Welche weiteren Angebote empfanden Sie als hilfreich?
Dr. Ramakers: Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir im Collective Incubator der RWTH Büroräume und Labore nutzen können. Damit vermitteln wir unseren Besucherinnen und Besuchern, dass wir nicht einfach aus einer Garage heraus starten, sondern einen großen Partner an unserer Seite haben, der uns als Gründungsteam unterstützt.
Gab es auch die eine oder andere Hürde, die Sie im Rahmen Ihrer Gründungsvorbereitungen nehmen mussten?
Dr. Ramakers: Ja, die gab es tatsächlich, und zwar bei der Suche nach geeigneten Investorinnen und Investoren. Stefan Jockenhövel und ich hatten beide auch am Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) gearbeitet. Dadurch waren wir häufig auf beiden Seiten der Grenze und dachten, es sei doch eine tolle Idee, als Start-up hier in der Grenzregion ein regionales Investorenkonsortium zusammenzustellen. Aber das ist uns leider nicht gelungen. Das Kirchturmdenken hat uns wirklich überrascht. Da hieß es dann: Ja, ihr bekommt das Geld, aber dann muss ein bestimmter Anteil eurer Tätigkeiten diesseits der Grenze liegen und genauso umgekehrt. Das war uns dann doch alles zu kleinteilig gedacht, so dass wir uns letztlich für große und international agierende VC-Gesellschaften entschieden haben.
Wie haben Sie die kennengelernt?
Dr. Ramakers: Es hat eine Weile gedauert. Wir mussten auch erst lernen, wie der VC-Markt für Start-ups so funktioniert. Ein Investor springt ja nicht allein auf eine tolle Idee an. Viel wichtiger ist die Frage, ob er am Ende sein Geld zurückbekommt und zudem einen guten Gewinn erzielt. Diese Renditeprognose muss man als Gründungsteam realistisch und glaubwürdig deutlich machen. Entsprechend haben wir unseren Businessplan dahingehend extrem geschärft und an mehreren Pitches der RWTH Innovation sowie von unserem Netzwerk teilgenommen. Bis dann tatsächlich ein Investor gesagt hat: Ja. Ich bin dabei, hier ist mein Commitment. Das war der Türöffner, so dass auf einmal auch andere Investorinnen und Investoren auf uns zukamen. Diese Fear of Missing out bzw. die Angst, als Kapitalgeber ein vielversprechendes Investment zu verpassen, ist ein sehr starker Wirkmechanismus. Dadurch waren wir in der luxuriösen Position, die Wahl zu haben und ein Investorenkonsortium zusammenzustellen, das auf Medizinprodukte spezialisiert ist.
Nehmen Sie denn auch öffentliche Förderprogramme in Anspruch?
Dr. Ramakers: Ja, wir nutzen verschiedene Programme. Eine wichtige Rolle spielt dabei der EIC Accelerator. Damit verbunden ist eine EU-Förderung von 2,5 Millionen Euro. Die Beantragung war wirklich ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt. In den Genuss der Förderung kommen ja praktisch immer nur eine Handvoll Leute. Aber wer den Zuschlag erhält, wird auf ein ganz neues Level gehoben. Das geht soweit, dass Investorinnen und Investoren sehr genau verfolgen, wer jeweils den EIC gewonnen hat und dann gezielt auf die Start-ups zugehen.
Neben der EU-Förderung nehmen wir auch Landes- und Bundesprogramme in Anspruch. Dazu gehört zum Beispiel das regionale Wirtschaftsförderprogramm (RWP). Damit erhalten wir Zuschüsse zu unseren Personalkosten, damit wir auch als Arbeitgeber in der Region wachsen können. Oder auch der INVEST – Zuschuss für Wagniskapital, der uns bei der weiteren Investorenakquise sehr wertvoll unterstützt. Also insgesamt sind wir finanziell nachhaltig aufgestellt.
Was würden Sie rückblickend als Ihre größten Erfolge bezeichnen?
Dr. Ramakers: Da würde ich an erster Stelle unser Team nennen. Dass wir wirklich zusammenstehen, uns persönlich sehr gut verstehen und uns bei unserer Arbeit optimal ergänzen. Die Kapitalausstattung durch VC-Geber und die erfolgreiche Einwerbung des EIC Accelerator Grants waren sicherlich große Erfolge in einem sehr kompetitiven Wettbewerbsfeld.
Inhaltlich haben die präklinischen Studien unsere Erwartungen übertroffen, so dass wir nun wissen, dass diese disruptive Therapie tatsächlich funktioniert. Dass die Durchführung der Versuchsreihe so gut geklappt hat, verdanken wir der ausgezeichneten Kooperation mit dem Institut für Angewandte Medizintechnik an der RWTH und der Uniklinik Aachen. Dafür sind wir sehr dankbar.
Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?
Dr. Ramakers: Wir sind gerade dabei, den Antrag für die klinische Studie vorzubereiten. Sobald die Bewilligung vorliegt, können wir endlich unsere Therapie am Patienten testen. Der Funktionsnachweis und der Nachweis der Sicherheit sind hier das vorrangige Ziel. Bis zum Markteintritt werden noch einmal etwa vier Jahre vergehen. Aber dann werden wir weltweit das erste Unternehmen sein, dass dieses neuartige Verfahren für Patientinnen und Patienten mit Hyperkapnie anbietet.
Weitere Informationen:
Stand: Februar 2025

Die Initiative Exzellenz Start-up Center.NRW fördert das Projekt „Building Europe’s leading integrated Tech Incubator“ an der RWTH Aachen University.
- Start-up Talk
- Interview mit Dr. Maximilian Hartmann, Co-Founder der vGreens Holding GmbH
- Interview mit Antonia Langner, Co-Founderin der LastBIM GmbH
- Interview mit Leo Wiegand, Co-Founder der ONE WARE GmbH
- Interview mit Dr. Richard Ramakers, Co-Founder der O11 biomedical GmbH
- Interview mit Dr. Adam Widera und Dr. Michael Middelhoff, Gründungsteam CrisisCube
- Interview mit David Goldschmidt und Finn Rübo, Co-Founder der Datapods GmbH
- Interview mit Maximilian Spiekermann und Max Krause, Gründungsteam Simplyfined
- Interview mit Dana Aleff, Co-Founderin der Circonomit GmbH
- Interview mit Pia Hildebrandt, Co-Founderin der concepte Solutions GbR
- Interview mit Moritz Schmidt, Co-Founder der utilacy GmbH
- Interview mit Tobias Barg und Dr. Felix Sümpelmann, Co-Founder der aalto Health GmbH
- Interview mit Dr. Katharina C. Cramer, Gründungsteam Tiller Alpha
- Interview mit Felix Kathöfer, Co-Founder der KATMA CleanControl GmbH
- Interview mit Ronja Weidemann, Fabienne Ryll und Abirtha Suthakar, Gründungsteam PhosFad
- Interview mit Benjamin Kasten, Co-Founder der ladeplan UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Prof. Dr. Rafael Kramann, Prof. Dr. Rebekka Schneider, Co-Founder der Sequantrix GmbH
- Interview mit Yasin Demir, Co-Founder der GreenDeal GbR
- Interview mit Katharina von Stauffenberg, Co-Founderin von comuneo
- Interview mit Sven Maihöfer, Co-Founder der xemX materials space exploration GmbH
- Interview mit Dr. Johannes Wappenschmidt, Co-Founder der Vintus GmbH
- Interview mit Tobias Burger, Co-Founder der red cable robots GmbH
- Interview mit Philipp Pflüger, Co-Founder der ChemInnovation GmbH
- Interview mit Deniz Ates, Co-Founder der Who Moves UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Jakob Vanhoefer, Gründer der LightningPose GmbH
- Interview mit Dr. Reza Esmaillie, Co-Founder der Detechgene GmbH
- Interview mit Lukas Klaßen, Co-Founder von „Knowledge in a Box“
- Interview mit Dr. Philipp Wrycza, Co-Founder der Logistikbude GmbH
- Interview mit Christoph Milder, DEVITY-Team
- Interview mit Jonas Spieth, Co-Gründer der lodomo GmbH
- Interview mit dem Gründungsteam der Laminar Solutions UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Alexander Pöhler und Xiaojun Yang, Gründungsteam der assemblean GmbH
- Interview mit Marc Leonard Leineweber, Gründungsteam HoLa
- Interview mit Dr. Niklas Hellemann, Co-Founder der SoSafe
- Interview mit Hendrik Bissing, Gründungsteam SLVISIONS
- Interview mit Elena Kirchner, Co-Gründerin der umaversum reproductive health GmbH
- Interview mit Gerrit Agel, Co-Gründer der CYBRID GbR
- Interview mit Lena Benecken, Co-Gründerin der EASI Control GmbH
- Interview mit Sinem Atilgan, Co-Grünerin der 4traffic SET GmbH
- Interview mit Doris Korthaus, Co-Gründerin der Korthaus Pumpen GmbH
- Interview mit Dr.-Ing. Friederike Kogelheide, Gründungsteam Glim Skin
- Interview mit Moritz Schmidt, Teammitglied von Gemesys
- Interview mit Dr. Alexander Schneider und Michael Birkhoff, Co-Gründer der schnaq GmbH
- Interview mit dem Gründungsteam von Acuire
- Interview mit Dr.-Ing. Peter Schlanstein und Niklas Steuer, Co-Gründer der HBOX Therapies GmbH
- Interview mit Sven Wauschkuhn, Co-Gründer der Excellence Coatings GmbH
- Interview mit Anne Janser, Co-Gründerin von WorXplorer
- Interview mit Paul Sabarny und Lilian Schwich, Gründungsteam der cylib GmbH
- Interview mit Stefan Paulus, Co-Gründer der azernis GmbH
- Interview mit Steffen Gerlach, Co-Gründer der EEDEN UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Sandra Stoppert, Gründerin von „Grünes Konfetti“ und „Tanzraum Remscheid“
- Interview mit Dr. David Dung, Gründungsteam Midel Photonics
- Interview mit Dr. Michael Schmidt, Co-Gründer von ESKITEC
- Interview mit Magnus Schückes, Co-Gründer der Elona Health GmbH
- Interview mit Alexander Haufschild, Co-Gründer der socialbnb GmbH
- Interview mit Jan Bernholz, Co-Gründer der eseidon GmbH“
- Interview mit Dr. Robert Brüll, Co-Gründer der FibreCoat GmbH
- Interview mit Dr. Matthias Kiel, Geschäftsführer der qubeto GmbH
- Interview mit Marius Ruhrmannm, Geschäftsführer der MapAd GmbH
- Interview mit Sigrid Dispert, Gründungsteam Memogic
- Interview mit Nathalie Prokop, Co-Gründerin von noho
- Interview mit Michael Rieger, Co-Gründer der FreeD Printing GmbH
- Interview mit Dr. Timo Bathe und Alexander Ott, die Gründer der [Tool]Prep UG (haftungsbeschränkt)
- Interview mit Sarah Theresa Schulte, Co-Gründerin der AllCup GbR
- Interview mit Christoph Seidenstücker, Co-Gründer der Pixel Photonics UG
- Jochen Schwill, Next Kraftwerke GmbH
- Thomas Roth, Co-Gründer des Medizintechnik-Start-ups InnoSurge AC
- Start-up Profiles